









Sofern gewünscht, übernehmen wir die Post vom Finanzamt, klären und wickeln frühzeitig alle amtlichen Anfragen ab, prüfen Bescheide, berechnen und überwachen die Erklärungs- und Rechtsbehelfsfristen.
In diesem Zusammenhang
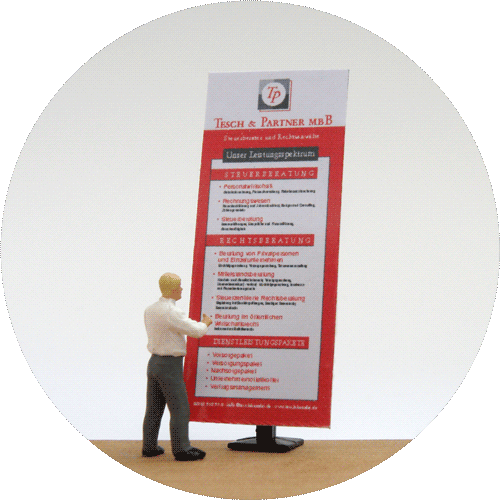
Sprechen Sie uns gerne an! Wir helfen Ihnen weiter! Zugunsten der Masse! Für Ihren Erfolg!

Neben der Übernahme von kompletten Finanzbuchhaltungen durch unsere Buchhalter steht bei größeren Verfahren mit eigener, funktionierender Finanzbuchhaltungs-Abteilung die Informationsweitergabe bzw. die Übermittlung neuer, durch das Verfahren begründeter, Buchungsregeln durch unsere Berufsträger im Vordergrund.
Allen Buchhaltungen ist gemeinsam, dass die Umsatzsteuer besonderes Augenmerk erfordert und Themen wie Zwangsverrechnung, Abgrenzung Masse- und Tabellenzeitraum, Realisation von Umsatz- aber auch Vorsteuer im eröffneten Verfahren im Alltag der Finanzbuchhaltungsmitarbeiter verankert sein müssen.
Die Beherrschung einer Reihe von Finanzbuchhaltungsprogrammen (neben der DATEV als dem hauseigenen System, SAP, navison) durch unsere erfahrenen Mitarbeiter ermöglich in der Regel eine rasche Einfindung in das vorgefundene System um ohne Unterbrechungen mit der Bereitstellung belastbarer Datensätze (Abgrenzungen im Bereich der Forderungen, SÜ-Waren oder Tabellenwerte) fortfahren zu können.
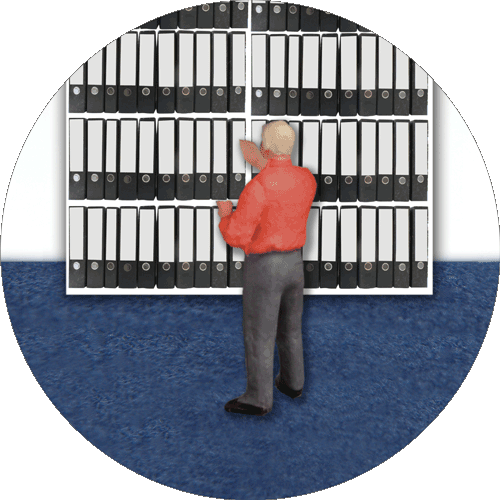
Auf dem Prinzip der Doppik beruht die gesamte Buchhaltung nach den im Jahr 1897 geschaffenen §§ 238 ff. HGB, aber auch die internationale Buchhaltung nach IFRS (International Financial Reporting Standards). Neben der steuerlichen Komponente der Buchführung (vgl. nur §§ 140 ff. AO, § 5 Abs. 1 EStG, § 8 Abs. 1 Satz 1 KStG) dient die HGB-Buchführung vordringlich dem Gläubigerschutz und der Kapitalerhaltung, während die Buchführung nach IFRS hauptsächlich den Eignern als Investorenschutz dient.
Gemeinsam sind beiden Ansätzen also die Information und der Schutz der Kapitalgeber mit unterschiedlichen Prioritäten. Gemeinsam ist den auf der Doppik beruhenden Buchhaltungssystemen ferner die Information der Geschäftsführung zwecks Vorbereitung und Überprüfung administrativer und operativer Entscheidungen; Nahtstelle zwischen Geschäftsführung und Buchhaltung ist insoweit das Controlling. Die Buchhaltung ist in ihrem Ergebnis, d. h. in der Darstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) im Jahresabschluss, ein hoch komplexes Rechtsgebiet geworden, das durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz im Jahr 2009 die größte Rechtsreform seit rd. 25 Jahren erlebt hat. Diese Ausführungen sollen zeigen, dass die Buchhaltung im Wirtschaftsleben eine tragende Säule ist. Ohne eine ausreichende Buchhaltung lässt sich ein Wirtschaftsunternehmen nicht steuern.
Auf der anderen Seite stehen die Regelungen zur Rechnungslegung nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. In §§ 666, 259 Abs. 1 BGB wird für die Abwicklung fremder Vermögensmassen lediglich eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung verlangt, die im Grunde nicht mehr ist als ein Kassenbuch. Dies kann jedoch bei näherer Betrachtung nur für einfache Vermögensabwicklungen gelten, wie z. B. die des Vormunds, des rechtlichen Betreuers, des Pflegers sowie des Testamentsvollstreckers. Schon der WEG-Verwalter kommt ohne Nutzung spezifischer Konten nicht aus und für den Zwangsverwalter ist die Verwendung von Sachkonten sogar ausdrücklich gesetzlich vorgegeben (§ 15 ZwVwV).
Die Buchführung im Insolvenzverfahren sitzt zwischen diesen beiden Stühlen, da der Gesetzgeber in § 155 lnsO und § 66 lnsO ohne Konkretisierungen beide Buchführungen verlangt. Allerdings verlangt der Gesetzgeber für die Verwalterbuchführung u. a. eine Abgrenzung von freier Masse und Absonderungsgut (vgl. §§ 166 ff. lnsO, § 1 Abs. 2 Nr. 1 InsVV), eine Abgrenzung von Abwicklung und Fortführung (vgl. §§151 Abs. 2 Satz 2, 157 Satz 1 lnsO, § 1 Abs. 2 Nr. 4 Satz 2 Buchst. b InsVV), eine Abgrenzung von Verfahrenskosten, sonstigen Masseverbindlichkeiten und Insolvenzforderungen (vgl. §§ 53-55, 209, 38, 39 InsO, §1 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 lnsVV) etc. Diese Abgrenzungen können nur durch die Verwendung von Sachkonten erfolgen, so dass etwas anderes als die doppelte Buchführung nicht in Betracht kommen kann. Der Gesetzgeber verlangt sogar eine Bestandsermittlung (§§ 151-153 lnsO), ohne jedoch buchhalterische Konsequenzen daraus zu ziehen, also den Bogen zur Doppik zu spannen. Der standardisierte Kontenplan SKR-InsO scheint zunehmende Anwendung zu finden, obgleich dieser Kontenplan nicht vollständig ist und immer noch Detailfragen offenlässt.
Auch in diesem Kontext ist die Umsatzsteuer in der Insolvenz wieder ein gewichtiges Thema. Denn bereits der Buchhalter muss entscheiden, welches Sachkonto für den jeweiligen Geschäftsvorfall das richtige und ob mit oder ohne Steuerschlüssel zu buchen ist.
Das Thema „Sondermassen“ stellt ein weiteres wichtiges Problemfeld im Rahmen der Insolvenzbuchführung dar. Hier sind nach wie vor Verteilungsfehler nicht ausgeschlossen, wenn die Geschäftsvorfälle nicht korrekt erfasst werden.

Die Analyse der Bilanzpositionen im Rahmen der Abschlusserstellung ist gleichwohl der Einstieg zum Verständnis der Geld- und Warenströme und ermöglicht so mögliche Ansprüche zu erkennen und zu verfolgen.
Hierdurch gewinnt diese Arbeit eine enorm wichtige Flankierungsfunktion.

Die anschließende Betreuung der laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnung, verbunden mit der Erstellung von etwaigen Sonderlohnabrechnungen sowie die Organisation eines rationellen Informationsflusses für die Anmeldung der Arbeitnehmerforderungen zur Insolvenztabelle kennzeichnen die Arbeiten im eröffneten Verfahren.
Die Sonderlohnabrechnungen umfassen neben der Differenzlohnabrechnung, der Abrechnung von Sozialplänen und arbeitsgerichtlichen Vergleichen auch die Komponenten aus der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und den Datenfluss zum Pensionssicherungsverein (PSV).
Die Betreuung der Altersteilzeit in der Insolvenz stellt eine weitere Besonderheit dar.

Danach kann ein Insolvenzverwalter Vermögenswerte zurückfordern, wenn der Insolvenzschuldner vor Verfahrenseröffnung eine Rechtshandlung vorgenommen hat, welche die Gesamtheit der Insolvenzgläubiger benachteiligt und ein Anfechtungsgrund vorliegt, der es rechtfertigt, die vom Schuldner erbrachte Leistung vom Anfechtungsgegner zurückzufordern ohne hierdurch die Rechtssicherheit des Geschäftsverkehrs unangemessen zu beeinträchtigen. Ein solcher liegt beispielsweise vor, wenn der Schuldner Vermögensgegenstände an Dritte verschenkt. Der Beschenkte ist weniger schutzwürdig als die Gesamtheit der Gläubiger, die infolge der Schenkung zunächst nicht auf den Vermögensgegenstand zurückgreifen können, da er für seinen Erwerb keine eigene Leistung erbringen musste.
Das Insolvenzanfechtungsrecht spielt in der Praxis eine unverändert große Rolle, wie auch die jüngsten Reformbemühungen zeigen, die im jüngsten Gesetz zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei Anfechtungen nach der Insolvenzordnung und nach dem Anfechtungsgesetz vom 29.3.2017 (BGBI. I S. 654) einen vorläufigen Abschluss gefunden haben.
Gleichzeitig hat das in wenigen gesetzlichen Tatbeständen geregelte Insolvenzanfechtungsrecht aufgrund der Vielgestaltigkeit der Rechtsfälle sowie durch Rechtsprechung und Schrifttum einen ganz erheblichen Umfang angenommen. Ständig neue Fragen stellen sich insbesondere im Zusammenhang mit der Anfechtung in sogenannten „Mehrpersonenverhältnissen“.
Auch wenn es die ureigene Aufgabe des Insolvenzverwalters ist, Anfechtungsansprüche zu ermitteln, so stößt dieser in der Praxis insbesondere im Bereich der Vorsatzanfechtung an seine personellen und logistischen Grenzen.
Ab einem gewissen Umfang kann der Verwalter daher – ohne Kürzung seiner Vergütung – einen Dienstleister mit der Ermittlung insolvenzspezifischer Ansprüche auf Kosten der Masse beauftragen.
Gerade wenn Sie eine Chance sehen, im Wege der Insolvenzanfechtung Verfahrenskostendeckung herbeizuführen, Masseunzulänglichkeit zu verhindern oder Berechnungsgrundlage und Vergütung zu erhöhen, sprechen Sie uns gerne an.
Wir können insolvenzspezifische Ansprüche ermitteln, Auswertung digitaler und analoger Buchhaltung und Korrespondenz vornehmen, bei Gutachten und Zwischenberichten zuarbeiten, Gutachten zum Eintritt der Zahlungsunfähigkeit erstellen und als Rechtsanwälte die so ermittelten Ansprüche auch gleich außergerichtlich oder nötigenfalls gerichtlich durchsetzen.
Das Outsourcing der aufwendigen Ermittlungsarbeit auf unsere erfahrenen Spezialisten reduziert nicht nur Ihr Haftungsrisiko, sondern spart Ihnen auch Zeit und Geld.
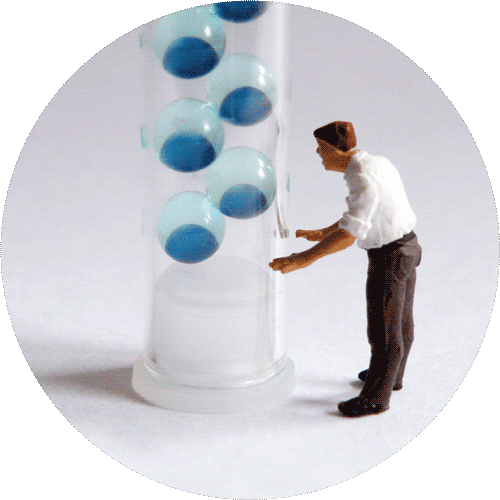
Vertrauen Sie auch bei der Prüfung des Zeitpunktes des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit bzw. drohenden Zahlungsunfähigkeit auf die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen diesen Service auch unabhängig von der Ermittlung insolvenzspezifischer Ansprüche an.

Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage des Bestehens einer bereits eingetretenen Insolvenzantragspflicht. Nach der Rechtsprechung des BGH müssen sich ein Geschäftsführer zur Vermeidung einer eigenen Haftung externe Beratung einholen, sofern er nicht (ausnahmsweise) über die erforderlichen Kenntnisse verfügt (BGH, 14.05.2007 – II ZR 47/06).
Eine Aufgabe des Insolvenzverwalters ist es, die Insolvenzgläubiger zu befriedigen. Die Insolvenzgläubiger werden aus der Insolvenzmasse befriedigt. Hier hinein fließt das gesamte Vermögen des Schuldners, das er zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hat und das er während des Verfahrens erlangt.
Der Insolvenzverwalter kann gegen den Geschäftsführer Ansprüche nach § 43 GmbHG geltend machen, wenn der Geschäftsführer bei Gesellschaftsangelegenheiten nicht die erforderliche Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns beachtet hat.
Er kann aber auch Ansprüche gegen den Geschäftsführer geltend machen nach § 64 GmbHG für Zahlungen, die nach Insolvenzreife an Gesellschaftsgläubiger bzw. Gesellschafter geflossen sind.
§ 64 GmbHG lautet wie folgt: „Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder nach Feststellung ihrer Überschuldung geleistet werden. Dies gilt nicht für Zahlungen, die auch nach diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmanns vereinbar sind…“.
Die Steuerberaterhaftung insbesondere für Insolvenzverschleppungsschäden kann sich insbesondere ergeben aufgrund der Grundsätze des BGH-Urteils vom 26.1.2017 – IX ZR 285/14. Mit diesem Urteil hat der BGH die Informations- und Hinweispflichten für Steuerberater nämlich deutlich verschärft. Laut der im Anschluss daran ergangenen Stellungnahme der BStBK hat der mit der Erstellung des Jahresabschlusses eines Unternehmens beauftragte Steuerberater die Verpflichtung zu prüfen, ob nach den ihm zur Verfügung stehenden Informationen und Unterlagen die Fortführung des Unternehmens gefährdet scheint. Der Steuerberater hat den Geschäftsführer auf die Krise hinzuweisen und die Erstellung einer Fortführungsprognose von einer fachkundigen Stelle anzuregen.
Möchte der Berater diese ihm hiermit auferlegten Pflichten erfüllen, erhöht er das Risiko einer späteren Anfechtung seiner Honorare im Fall der Insolvenz der Mandantin beträchtlich. Der Steuerberater hat also ohnehin eigentlich nur die Wahl zwischen einer persönlichen Haftung für den Insolvenzverschleppungsschaden und einem deutlich erhöhten Anfechtungsrisiko. Den Berater schützt in dieser Situation nur ein fundiertes Prüfungsergebnis, das den Eintritt der Insolvenzreife verneint, was er aber allzu häufig nicht wird vorweisen können.
Beide Haftungsschuldner sind aus Sicht der Insolvenzmasse interessant, da der Steuerberater in der Regel über eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung und der Geschäftsführer zumindest häufig über eine D&O-Versicherung verfügt und sich damit die Masse in erheblichem Maße anreichern lässt. Und wir können Sie hierbei in geradezu idealerweise unterstützen, weil wir als doppelt qualifizierte Rechtsanwälte und Steuerberater sowohl das Fehlverhalten des Steuerberaters bei der Bilanzaufstellung aus eigener Anschauung beurteilen können, als auch selbst in der Lage sind, den Anspruch vor den Zivilgerichten zu Gunsten der Masse durchzusetzen.

Angesichts der mit der Verwaltung und Verwertung von Grundbesitz verbundenen rechtsübergreifenden Sachverhalte fordert der Umgang mit Immobiliarvermögen im Insolvenzverfahren und Sanierungsprozess Kenntnisse von u. a. zwangsversteigerungs-, grundbuch-, sachen-, steuer- und insolvenzrechtlichen Normen und Zusammenhängen.
Neben Kenntnis der typischen Verwaltungs- und Verwertungsmethoden verfügen wir über erhebliche Erfahrung in den regelmäßig aufkommende Begleitfragen im steuerlichen und vergütungsrechtlichen Zusammenhang sowie in den Spezialfragen u. a. aus den Bereichen des Anfechtungsrechts, der Aus- und Absonderungsrechte sowie der Bedeutung von Grundbesitz im Insolvenzplanverfahren.

Wenngleich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen aktuell einen historischen Niedrigstand erreicht hat, ist infolge der sich dynamisch verändernden Rahmenbedingungen die strategische Krise in zahlreichen Unternehmen durch rückläufige Umsätze und Marktanteile spürbar. Zugleich übertünchen historisch niedrige Zinsen die Erosion von Geschäftsmodellen und stellen oftmals die ansonsten fragliche Zahlungsfähigkeit bzw. positive Fortführungsprognose sicher.
Gleichzeitig hat der Gesetzgeber mit dem ESUG von 2012 die Rahmenbedingungen für eine Restrukturierung im Insolvenzplanverfahren verbessert.
Zunehmend bedeutet das Insolvenzverfahren nicht mehr die Liquidation des Unternehmens, sondern ermöglicht mittels eines Insolvenzplans eine echte Sanierung des Schuldners . Mit dem Insolvenzplan können flexible Lösungen für ein Unternehmen gefunden werden. Der Gesetzgeber des ESUG hat insbesondere die Möglichkeit geschaffen, gesellschaftsrechtliche Strukturmaßnahmen wie z. B. Kapitalerhöhungen (insbesondere in der Form eines Debt-EquitySwaps) oder Umwandlungen nach dem Umwandlungsgesetz unmittelbar im Plan und vorrangig unter den insolvenzrechtlichen Vorgaben zu treffen. Im Insolvenzplan ist somit vieles möglich, aber auch vieles zu beachten: Ein Insolvenzplanverfahren erfordert die präzise Abstimmung mit Fragen des Gesellschafts-, Arbeits-, Bilanz- und Steuerrechts sowie des internationalen Privat- und Prozessrechts, zunehmend auch mit dem Schuldverschreibungsrecht und mit anderen Materien wie z. B. Fragen der Unternehmensbewertung.
In diesem schwierigen wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld können wir Sie mit folgenden Dienstleistungen unterstützen:

Im Rahmen von Fortbestehensprognose oder Sanierungsgutachten wird ebenfalls die Überlebensfähigkeit und damit der Ausschluss von Insolvenzgründen geprüft.
Dies gilt nicht nur in der Krise der Gesellschaft bzw. im laufenden Sanierungsverfahren. Die Anlässe, die Insolvenzgründe zu überprüfen bzw. zu überwachen, sind vielfältig.
Bei ertragsschwachen oder kriselnden Unternehmen stellt sich im Rahmen der Aufstellung der Handelsbilanz regelmäßig die Frage, ob der Jahresabschluss noch unter der Annahme der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern) erstellt werden kann. Hier kann eine fachkundige Stellungnahme zur Beurteilung erforderlich sein.
Bei der Finanzierung von ertragsschwachen Unternehmen wird immer öfter eine Bescheinigung über die künftige Kapitaldienstfähigkeit verlangt. Diese deckt sich im Wesentlichen mit dem Ausschluss der drohenden Zahlungsfähigkeit und damit mit der Verneinung der Existenz von Insolvenzgründen. Aufgrund der weitreichenden Haftung etwaiger Kreditgeber notleidender Unternehmen und zum Ausschluss der Vorsatzanfechtung (Anfechtung gem. § 133 Abs. 1 InsO) verlangen Banken derartige Überprüfungen zur Vorbereitung ihrer Kreditentscheidungen.
Soweit ein Insolvenzplan die Befriedigung der Gläubiger aus künftigen Erträgen vorsieht, sind dem Insolvenzplan prüfbare Planungsunterlagen beizulegen. Aus diesen muss die finanzielle Möglichkeit, die Gläubiger zu befriedigen, dokumentiert werden.
Ein Käufer eines Unternehmens wird vor dem Kauf einen Solvency-Test anstellen, um zu überprüfen, ob das Unternehmen nach dem Kauf für sich überlebensfähig ist. Soweit Garantien vom Verkäufer verlangt werden, dass keine Insolvenzreife besteht, wird auch der Verkäufer eine entsprechende Überprüfung anzustellen haben. Entsprechendes gilt für Gläubiger, die entweder außergerichtlich oder in einem Insolvenzplan ihre Forderungen in Eigenkapital tauschen (Debt to Equity Swap).
Aber auch bei laufenden „gesunden“ Unternehmen stellt sich in verschiedenen Situationen das Erfordernis eines solchen Solvency-Tests. Soweit etwa ein Strategiewechsel geplant ist, stellt sich die Frage, ob die Ressourcen ausreichen, um den Strategiewechsel zu vollziehen. Dies geschieht üblicherweise auch mithilfe eines Solvency-Tests.
Ferner ist er ein Teil des Risikomanagements und ein Teil des Risikofrüherkennungssystems. Die Reichweite eines Solvency-Tests ist mittelfristig. In der Regel werden dabei 3 bis 8 Jahre untersucht. Insoweit können also sehr frühzeitig Fehlentwicklungen erkannt werden.
Auch für die Optimierung der Kapitalstruktur ist ein Solvency-Test ein wertvolles Hilfsmittel.
So kann auch im Rahmen einer Spaltung ein Anlass bestehen, die Überlebensfähigkeit der Gesellschaften in Form einer Planungsrechnung zu dokumentieren.
Aufgrund der weitreichenden Planungsperspektive kann der Solvency-Test zur Vorbereitung von Umstrukturierungen im Zuge von Asset-Protection-Maßnahmen steuernd eingesetzt werden.
Zum Schluss machen manche Versicherer im Rahmen der Organ-Versicherung (D & O-Versicherung) eine entsprechende Planung zur Voraussetzung des Versicherungsschutzes.
Die Prüfung der Insolvenzreife bzw. die Erstellung eines Solvency Tests ist eine interdisziplinäre Beratungsaufgabe. Erforderlich ist neben insolvenzrechtlichem Know-how betriebswirtschaftliches, insbesondere finanzwirtschaftliches Know-how. Der Berater muss nämlich in der Lage sein, eine Unternehmensplanung zu erstellen oder eine erstellte Unternehmensplanung zu analysieren. Ferner benötigt er profunde Kenntnisse der Unternehmensbewertung. Aufgrund der Ungewissheit der Zukunft ist zudem statistisches Wissen bzw. Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsrechnung unabdingbare Voraussetzung.
Derartige Überprüfungen finden gerade nicht im rechtsfreien Raum statt. Der Ersteller eines Solvency-Tests muss immer davon ausgehen, dass in der Folge seine Stellungnahme einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen wird. Aus diesem Grund werden entsprechend den Beweislastregelungen die Sachverhalte dokumentiert und auf gerichtliche Verwertbarkeit überprüft.
Adressaten unserer Dienstleistung:
Unsere Dienstleistung richtet sich nicht nur an Insolvenzverwalter, Geschäftsführer und Vorstände. Vielmehr erbringen wir unsere Dienstleistung auch für Aufsichtsräte, Gesellschafter, Kapitalgeber, insbesondere Banken und Private-Equity-Gesellschaften sowie für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die fachkundige Stellungnahmen zur Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit im Rahmen der Bilanzierung benötigen.
Aufbau unserer Dienstleistung:
Unsere Dienstleistung ist mehrstufig aufgebaut. Zunächst geht es darum, eventuell bestehende gesetzliche Insolvenzantragspflichten zu prüfen: d.h. Insolvenzantragspflichten und -rechte werden ermittelt. Hierzu prüfen wir das Vorliegen von Zahlungsunfähigkeit, drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, insbesondere das Vorliegen einer positiven Fortbestehensprognose. Die Handlungspflichten und -alternativen werden dann in einem schriftlichen Bericht dargestellt.
Bei haftungsbeschränkten Gesellschaften (z. B. GmbH, GmbH & Co. KG, AG) ist die Erstellung einer Fortbestehensprognose erforderlich, wenn nicht dokumentiert werden kann, dass ein Vermögensstatus unter der Annahme der Liquidation eine Schuldentilgung aufweist.
Auftragsumfang:
Den Auftragsumfang bestimmen wir vorab im gemeinsamen Gespräch mit Ihnen. Aufgrund der Zukunftsbezogenheit der Beratungsleistung regeln wir dabei, wie wir mit der Ungewissheit der Prognose umgehen, also ob wir in Bandbreiten, Szenarien planen oder ob eine sog. Monte-Carlo-Simulation zur Abbildung der möglichen Schwankungen erstellt wird.
Unsere Beratung erbringen wir auf Basis eines schriftlichen Angebots. Die Preise der Leistungen werden individuell festgesetzt. In der Regel bieten wir Ihnen neben berufsüblichen Stundensätzen eine Beauftragung zum Festpreis an.
Ihr Nutzen:
Sie vermeiden eine Haftung und kommen einer gesetzlichen Pflicht nach: Bei Gesellschaftsformen, bei denen keine natürliche Person persönlich haftet (AG, GmbH, GmbH & Co. KG etc.), sind Sie zur Einholung eines fachkundigen Rats verpflichtet, BGH vom 14.5.2007 II ZR 48/06.
Organe sind für die Organisation des von ihnen geführten Betriebs verantwortlich. Insbesondere folgt aus der Organschaftsstellung die Verpflichtung, ein Frühwarnsystem einzurichten und ein Risikomanagementsystem zu unterhalten. Grundlage eines solchen Systems ist eine langfristige strategische und operative Unternehmensplanung.
Darüber hinaus wird der Solvency-Test für strategische Entscheidungen bedeutsam. Insbesondere wenn es darum geht, Strategie-Änderungen, Umstrukturierungen und Strukturmaßnahmen durchzuführen, ist zur Vorbereitung und zur Ermittlung etwaiger Entscheidungsgrundlagen ein Solvency-Test von besonderer Bedeutung. Eigen- und Fremdkapitalgeber machen ihre Entscheidung zur Finanzierung der Gesellschaft abhängig von der nachhaltigen Überlebensfähigkeit, also vom Bestehen eines Solvency-Tests.
Der Solvency-Test vermeidet damit nicht nur die persönliche Haftung der Organe, sondern sichert auch den Zugang zu Kapital.
Checkliste – Hier ist ein Solvency-Test bzw. die Überprüfung von Insolvenzgründen entbehrlich:

Hierzu gehören insbesondere:
Die Tabellenführung erfolgt in den gängigen insolvenzspezifischen Programmen: IC12, EGC-InsO und winsolvenz.p4.

Die Gläubigerversammlung beschließt im Berichtstermin auf der Grundlage des Berichts des Insolvenzverwalters, ob das Unternehmen des Schuldners stillgelegt oder vorläufig fortgeführt werden soll. Sie kann den Verwalter beauftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und ihm das Ziel des Plans vorgeben. Die Gläubigerversammlung hat darüber hinaus über alle bedeutsamen Rechtshandlungen zu entscheiden.
Wir unterstützen Sie gerne bei der durchaus aufwändigen Durchführung derartiger (Groß-) Veranstaltungen.


Inventarisierungen für Insolvenzverwalter – schnell und bundesweit:
Die Inventarisierung des mobilen Anlagevermögens bezieht sich auf Fahrzeuge, Maschinen, Büroausstattung und weiteres bewegliches Betriebsvermögen. Es handelt sich um eine Aufgabe, deren Resultate bis ins kleinste Detail stimmen müssen.
Wir führen die Abläufe ordnungsgemäß für Sie durch und bieten ein Endergebnis, das konkrete Aussagen über das Inventar des betroffenen Unternehmens oder der Institution ermöglicht. Um dies garantieren zu können, führen wir im Voraus ein umfangreiches Gespräch mit Ihnen, in dem wir die Inventarisierung planen.
Professionelle Verwertungsmaßnahmen im Auftrag von Insolvenzverwaltern:
Wenn Sie als Insolvenzverwalter die Objekte aus einer Standortschließung verwerten müssen, kümmern wir uns um die zügige Abwicklung des Prozesses. Wir erstellen marktgerechte Gutachten, katalogisieren und vermarkten die Objekte gemeinsam mit unseren Netzwerkpartnern. Unsere Leistungen:
Wir übernehmen sämtliche Schritte, die notwendig sind, um ein Objekt erfolgreich zu verwerten.
Sie profitieren von einer schnellen Abwicklung und kurzen Auktionslaufzeiten.
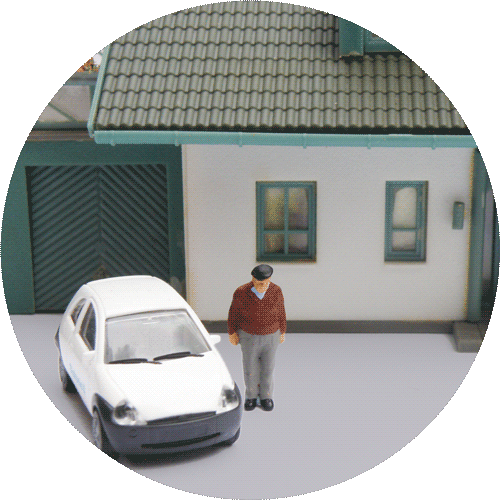
Neben der Unterstützung im eigentlichen Zwangsverwaltungsverfahren helfen wir Ihnen dabei Ihren steuerlichen Erklärungspflichten nachzukommen, da der Zwangsverwalter nach der jüngeren BFH-Rechtsprechung die Einkommensteuer des Vollstreckungsschuldners zu entrichten hat, soweit sie aus der Vermietung der im Zwangsverwaltungsverfahren beschlagnahmten Grundstücke herrührt, vgl. z.B. BFH v. 07.01.2019 – IX B 79/18.
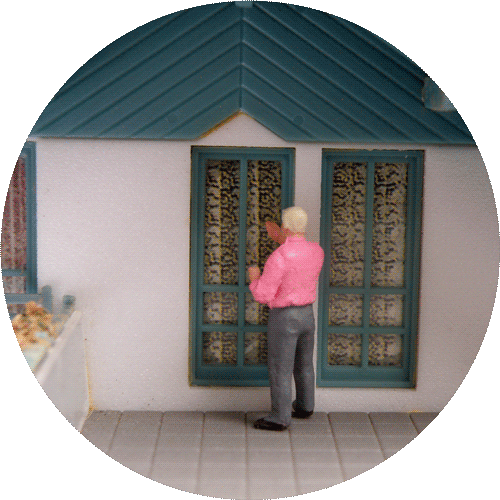
Mit unserem externalisierten Aktenarchiv sparen Sie sich „wertvollen“ Kanzleiraum. Ihre Akten werden in speziell dafür vorgesehene Archivkartonagen verpackt. Der Transport dieser Kartons erfolgt anschließend durch verschlossene und gesicherte LKW in das externe Archiv. Über ein zugangsgesichertes Webportal haben Sie nach Legitimation jederzeit die Möglichkeit den Bestand Ihrer Akten einzusehen und anzufordern. Auf Ihre konkrete Anforderung (z. B. nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist) vernichten wir die Akten auch fach- und datenschutzgerecht.
Ihre Vorteile:

Insoweit können wir nach Ihrer Wahl entweder nur das notwendige Zahlenmaterial für Sie aufbereiten oder gleich den gesamten Schlussbericht nach Ihrem Muster fertigen.

Die Regelung des § 65 der Insolvenzordnung überlässt der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung (InsVV) die Ausgestaltung der Vergütung der Vergütungsberechtigten, ergänzt um Vorgaben in § 63 und § 64 der Insolvenzordnung. Die lediglich zwanzig Paragrafen der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung unterscheiden sich vom Umfang und der Regelungsdichte her enorm von anderen Regelungen des Kostenrechts, wie etwa im Gerichtskostengesetz.
Wir übernehmen für Sie:

In den meisten Fällen richten sich die strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung gegen die Geschäftsführer und/oder Gesellschafter einer Gesellschaft.
Dies kann weitgehende Folgen haben: So besteht eine persönliche zivilrechtliche Haftung gemäß § 64 GmbHG für Zahlungen nach Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Nach § 6 GmbHG kann eine Verurteilung wegen eines Insolvenzdelikts sogar einer zukünftigen Tätigkeit als GmbH-Geschäftsführer entgegenstehen. Gewerbetreibenden droht der Entzug der Gewerbezulassung (vgl. § 35 GewO).
Der häufigste strafrechtliche Vorwurf im Zusammenhang mit der Krise eines Unternehmens ist der Vorwurf der Insolvenzverschleppung gemäß § 15a InsO. Der Tatbestand dieser Norm ist schnell erfüllt, da ein Geschäftsführer innerhalb einer sehr kurzen Frist von drei Wochen nach den ersten Anzeichen einer dauerhaften unternehmerischen Krise dazu verpflichtet ist, einen Insolvenzantrag zu stellen.
Voraussetzung für die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, ist die sogenannte Insolvenzreife. Diese liegt vor, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist.
Überschuldung wird angenommen, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich (vgl. § 19 Abs. 2 InsO).
Besonderes Augenmerk ist bei der rechtlichen Diskussion einer Überschuldung darauf zu legen, ob tatsächlich alle Gegenstände, die nach handels- oder steuerrechtlichen Bilanzvorschriften nicht aktivierbar sind (beispielsweise materielle Wirtschaftsgüter), bei der insolvenzrechtlichen Forderungsaufstellung berücksichtigt wurden. Nicht selten führen verschiedene Bewertungsmethoden zu unterschiedlichen Ergebnissen. Zu berücksichtigen sind insoweit – vor allem auch im Rahmen der Verteidigung – weite Beurteilungsspielräume bei der Bewertung von stillen Reserven, Rangrücktrittserklärungen, Forderungsverzichtserklärungen sowie Patronatserklärungen.
Zahlungsunfähigkeit liegt nach der gesetzlichen Definition vor, wenn ein Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Sie wird in der Regel angenommen, wenn ein Unternehmen seine Zahlungen eingestellt hat. Von der Zahlungsunfähigkeit ist die bloße Zahlungsstockung abzugrenzen, d.h. der kurzfristig behebbare Mangel an flüssigen Mitteln. Bei der Abgrenzung ist zu prüfen, ob die Zahlungsfähigkeit beispielsweise durch Kredite, Zuführung von Eigenkapital, Einnahmen aus dem normalen Geschäftsbetrieb oder der Veräußerung von Vermögensgegenständen wieder hergestellt werden kann.

Die unternehmenstypischen Pflichten, die der Insolvenzverwalter übernimmt, sind vielfältig. Es besteht das Risiko, dass der Insolvenzverwalter branchentypische Strafrechtsrisiken übersieht und Strafbarkeitstatbestände verwirklicht, die ihm möglicherweise überhaupt nicht präsent sind. Eine Schuldbefreiung aus Unkenntnis erfolgt nicht.
Die Nichtbeachtung steuerlicher Pflichten kann einerseits zu empfindlichen Strafen führen, andererseits – wenn Fehler durch die Ermittlungsbehörden erfolgen – aber auch zu Verfahrenseinstellungen oder sogar Freisprüchen.
Wir unterstützen Sie im Schnittbereich zwischen Steuerrecht, Steuerstrafrecht und Insolvenzrecht.


Diese Website kann Cookies verwenden, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden im Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit die Einstellungen für die Cookie-Einstellungen gespeichert werden können.
Wenn diese Cookies deaktiviert werden, können die Einstellungen nicht gespeichert werden. Dies bedeutet, dass bei jedem Website-Besuch, die Cookies erneut aktiviert oder deaktiviert werden müssen.
Mehr Informationen über unsere Cookie-Richtlinien